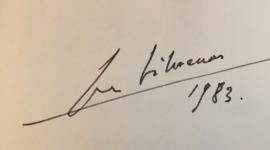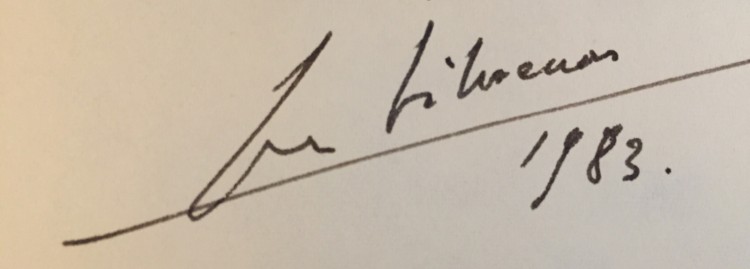
Bildnachweis: Unterschrift - - Bearbeitung: maigret.de
Seite 446
Bevor es düster wird, fange ich mit einem beschwingten Thema an: Simenon lässt sich zu Beginn des 41. Kapitels darüber aus, wie wohl er sich auf der Shadow Rock Farm fühlte und wie sehr ihn Land und Leute faszinierten. In seinen Worten: Er war zu Hause. Das Gefühl hatte er lange Zeit nicht mehr gehabt, schon gar nicht in Amerika. Aber nun war er bereit, sich einbürgern zu lassen.
Er spricht von Zauber. Die Bilder, die er sieht, würden denen einer alten Bäuerin ähneln, die in der Nähe leben würde. Er nennt auch ihren Namen:
Ich wurde nicht müde, sie zu bewundern, denn vor allem im Winter ähnelte die Umgebung im Rahmen jedes Fensters den Gemälden von Grandma Moses, einer Bäuerin, die weniger als hundert Meilen von Lakeville entfernt wohnte und die im Alter von achtzig Jahren angefangen hatte zu malen, was sie um sich herum sah.
Mit so einem Namen, dachte ich mir, würde es »ganz leicht« werden, herauszufinden, um wen es sich handeln würde. Leicht könnte man ihn für eine Keks-, Milch- oder Eiscreme-Marke halten, keine Frage. Um es ganz frei heraus zu sagen: Ich hatte keine großen Hoffnungen, dass ich fündig werden würde.
Probieren Sie es mal selbst! Selbst wenn Sie mit deutschen Such-Einstellungen in ihrer Lieblingssuchmaschine im Internet arbeiten, werden Sie mit dem ersten Ergebnis schon glücklich sein. (Okay – vorausgesetzt, dass Sie einen Werbefilter aktiv haben. Andernfalls kann ich die Garantie nicht geben.) Oma Moses ist nicht eine alte Dame, die in der Nähe von Simenon mal angefangen hat, irgendetwas zu malen, sondern sie hat bis heute einen Namen in der Kunstszene. Ich tendiere dazu zu sagen, dass man das wissen kann, aber nicht muss – letztlich vertrete ich diese Position wahrscheinlich deshalb, um mich zu trösten.
Die malende Omi
Das Talent hatte Anna Mary Robertson Moses wohl immer gehabt. Wenn die Eltern Bauern sind und man neun Geschwister hat, fällt die Kunstförderung wahrscheinlich hinten über. Sie malte in Kunstunterricht der Schule, aber diese besuchte sie nicht lang. In ihrem Nachruf ist davon die Rede, dass sie sich als Kind Farbe aus Zitrone und Traubensaft mischte. Mit zwölf Jahren wurde sie schon aus dem Haus geschickt und hatte bei einer betuchteren Familie in der Nähe im Haushalt mitzuarbeiten. Die folgenden fünfzehn Jahre war sie derart beschäftigt, bevor sie auf einem der Bauernhöfe, auf dem sie angestellt war, ihren Mann Thomas Salomon Moses kennenlernte.
In der Zeit lebte sie in Virgina, wo sie gemeinsam mit ihrem Gatten nach vielen Bediensteten-Stellen, eine eigene Farm kaufte. Aber den Mann hielt es dort nicht, er wollte zurück in den Bundesstaat New York, wo sie geboren waren. Sie zogen nach Eagle Bridge. Über die Jahre gebar sie zehn Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten. Sie dekorierte und bastelte, aber Kunst hätte sie das nicht genannt. Vielmehr ging es um Wohnlichkeit.
1927 starb ihr Ehemann und sie bewirtschaftete die Farm mit ihrem Sohn weiter. Mit Erreichen des Rentenalters zog sie zu ihrer Tochter – das war im Jahr 1936 und Grandma Moses war zu dem Zeitpunkt Mitte siebzig.
Malerei war gar nicht das, was ihr in dem Alter vorschwebte. Vielmehr arbeitete sie an Stickereien. Just in der Zeit ihres Umzugs zur Tochter fing eine Arthritis an, ihr Scherereien zu machen. Eine ihrer Schwestern schlug vor, sie möge sich der Malerei zuwenden. Das war eine Idee. Später erzählte Grandma Moses, dass sie ein Weihnachtsgeschenk für den Briefträger benötigte. Das Backen eines Kuchens hielt sie für zu mühsam und deshalb fing sie an zu malen. Achtzig war sie zu der Zeit, so wie es Simenon schrieb, noch nicht. (Es ist schließlich kein Alter mehr, in dem man sich unbedingt älter macht, als man ist.)
Glücklich, wer eines ihrer Frühwerke ergattert hatte. Die waren für drei bis fünf Dollar zu bekommen. Später wurden ihre Werke für Preise von bis zu 10.000 Dollar gehandelt. Im November 2006 – da war Grandma Moses schon 45 Jahre tot – wurde eines ihrer Bilder für 1,2 Millionen Dollar verkauft. Das hätte sie sich nicht träumen lassen.
Zumal es mit ihrer Kunstkarriere nicht so rasant voranging, wie man es sich für ein so fortgeschrittenes Alter erhofft. Der Kunstsammler Louis J. Caldor hatte eines ihrer Bilder in einer örtlichen Drogerie in Hoosick Falls gesehen und kaufte deren Gemälde-Vorräte wie auch die von der Maler-Oma auf, um sie in New York an den Mann zu bringen. Das Geschäft seines Lebens war das anfangs nicht. In New York erfolgte der Durchbruch erst, als es ihm gelang, die Bilder in einer Ausstellung des Museum of Modern Art unterzubringen, in der es um unbekannte zeitgenössische Maler ging.
Es sollte noch besser werden: Es gab viele Ausstellungen mit ihren Bildern, rund um die ganze Welt. Ihre Motive wurden nicht nur auf Grußkarten für Feiertage gedruckt, sie fanden sich auch auf Fließen und Stoffen wieder. In der Werbung nutzte man sie, um für Kaffee, Lippenstift und Zigaretten zu werben. Sie war in den fünfundzwanzig Jahren ihres malerischen Schaffens ungeheuer produktiv: Sie schuf über 1500 Gemälde. Auf den meisten Motiven fand sich das ländliche Leben Neuenglands wieder, so wie sie es kennengelernt hatte. Moderne Errungenschaften wie Traktoren und Telefonmasten wurden auf ihren Bildern ausgespart. Sie hatte ein Faible für Winterlandschaften, weshalb Simenon auch auf sie zu sprechen kam.
Dabei blieb, so wird der Eindruck vermittelt, selbst bescheiden. War sie auf ihre Bilder stolz? Vielleicht, aber in dem Film »True Confessions« von 1947 hieß es, dass sie »stolzer auf ihre Konserven war« und von noch mehr Stolz erfasst war, wenn es um ihre Kinder, Enkel und Urenkel ging.
Sie starb im Alter von 101 Jahren.
Simenon mochte die »naive und erfrischende Malerei« der Frau und erzählte, dass er sie in New York für sich entdeckt hatte.
Irritierendes
Die Winter waren schon etwas Besonderes in Neuengland. Blauäugig konnte man ihm nicht entgegentreten, für die kalte Jahreszeit musste man präpariert sein. Simenon schrieb, dass er an seinem Haus eine Reihe von Holzschienen entdeckte und nichts damit anzufangen wusste. Ein Freund von ihm, der Rechtsanwalt Beckett, erklärte ihm, was er damit anzustellen habe.
»Wozu dient das?«
»Um sie im Winter auf Ihren Gehsteig zu legen, denn bei Schnee und Eis könnten Sie dort nicht entlanggehen.«
Aber nicht nur das! Der Belgier bekam den dringenden Rat, im Winter im Kofferraum seines Fahrzeuges immer eine Schaufel und Sandsäcke vorrätig zu halten. Eigentlich war das kein Tipp im herkömmlichen Sinne, sondern der Verweis auf bestehende Vorschriften.
Die Beschäftigung mit dem Thema brachte einen anderen wunden Punkt zutage. Denn natürlich mögen es viele Menschen, wenn sie ein wenig abgelegen wohnen. Wenn es aber hart auf hart kommt – und der Schnee in Connecticut kann in die Kategorie »Härte« fallen –, gibt es aus dem wunderschönen Zuhause kein Entkommen mehr. Ihm wurde empfohlen, sich einen Schneepflug für sein Auto zu besorgen.
Da ist nicht mehr vom Kombi die Rede, den Simenon in New York gekauft hatte. Sie besaßen nun einen ausgewachsenen Jeep von der Größe eines Land Rover, der dafür gemacht war. Während das Fahrzeug dafür gemacht war, aufgerüstet zu werden, war jemand anders nicht dafür prädestiniert: der Schriftsteller. Er sagte von sich selbst, dass er keine Begabung für solche handwerklichen Tätigkeiten hatte und hatte erhebliche Zweifel, dass das bei eisiger Kälte besser werden würde. Er fand eine elegante Lösung: Mit den Automechanikern, die ihm den Pflug verkauft hätten, schloss er einen Dienstleistungsvertrag ab und die sorgten nun dafür, dass seine Auffahrt im Falle von Schnee geräumt wurde.
Der Wikipedia-Eintrag zu Torrington (Connecticut), zumindest der deutschsprachige, ist nicht besonders umfangreich und könnte um eine skurrile Tatsache ergänzt werden: Denyse kauft dort voller Begeisterung ihren ersten Tischstaubsauger. Dieser Enthusiasmus an sich ist zu verstehen, aber das, was daraus werden sollte, irritiert schon, und die Tatsache, dass sie es nicht aus dem Text herausgeklagt hat, spricht für einen gewissen Wahrheitsgehalt. Dieser Mini-Staubsauger sollte Teil des Reisegepäcks der Simenons werden. Wann immer sie nun ein Hotelzimmer betraten, machte sich Denyse nackig, räumte die Schubladen aus, saugte ein wenig herum, beglückte die Fächer mit neuem Papier und desinfizierte den Rest des Zimmers. Uns ist dabei schon bewusst, dass die Simenons überwiegend in Luxus-Hotels nächtigten …
So wie sie in den besten Hotels abstiegen, auch wenn sie noch ein wenig von der Ehefrau verfeinert wurden, so waren sie in den feinsten Restaurants und Clubs in New York City unterwegs. Dort kannte man die beiden gut, wusste, was sie mochten, schätzte sie. Geschäfte ließen sich gut abschließen, wenn eines sich als nicht astrein herausstellen sollte. Bei dieser Transaktion sollte Simenon für die Filmrechte nicht in Geld, sondern in Naturalien entlohnt werden. Der Produzent kannte einen Kürschner, der die besten Pelze anbot. Dort sollte sich Denyse ein Kleidungsstück ihrer Wahl aussuchen können. Mit glänzenden Augen holte sie sich das Stück Fell und zurückblieb nicht ein Produzent, der traurig über die hohen Kosten war, sondern ein Ehemann, der den Pelz bezahlte. Dreißig Jahre später konnte Simenon über die Episode zumindest schmunzeln.
Marc war sportlich und suchte sich herausfordernde Sportarten. In Neuengland war man dem Eishockey-Spiel sehr zugetan und auch Simenons Sohn konnte sich dafür begeistern. Die Mannschaft seiner Schule spielte gegen Mannschaften anderer Schulen. Die Eltern organisierten den Transport und so war der Jeep Simenons hin und wieder ein Eishockey-Spieler-Transport. Bei der Witterung, die da oft herrschte, war er als Vater sehr vorsichtig beim Fahren, um bei der Sporthalle anzukommen und zu sehen, dass man vorsichtshalber ein Krankenwagen bereitgestellt hatte. Bei dem Sport wusste man ja nie!
Egal, was er von dem Sport hielt, aber er erreichte durch solche Aktivitäten etwas, was ihm von Freunden und Bekannten eingebläut worden war:
»Here, you have to belong …«
»Sie müssen dazugehören … ein Teil werden …«
Sein alter Freund Jean Renoir hatte ihn eingeweiht und erklärt, dass Amerikaner ein Club-Denken haben. In einem solchen kann man durchaus Gast sein, aber irgendwann wird einem klar (oder auch klar gemacht), dass es nicht reicht und man Mitglied werden sollte. So würde es sich auch mit der Staatsbürgerschaft verhalten. Simenon war bereit, er wollte Mitglied in dem Club werden.
Er beschaffte sich Bücher, probte für den Test, machte sich bereit. Seine Vorbereitungen wurden aufgehalten durch einen Brief, den er von einem Mitglied der Académie Royale de Langue Française de Belgique bekam, und in dem man ihm die Aufnahme anbot. Simenon sah in seinen Staatsbürgerschaftsbemühungen einen Hinderungsgrund für die Akademie-Aufnahme, aber man beruhigte ihn. Er müsse nur zuerst Mitglied der Akademie werden, dann hätte niemand etwas dagegen, wenn er amerikanischer Staatsbürger wäre. Andersrum wäre nicht so toll …
Wie es so oft im Leben ist, sollte ihm die Entscheidung von einem Dritten abgenommen werden. Zwar indirekt, aber dafür sehr entschieden.
Irrwege
Der Mann war ein Kind der Mitte – zumindest, wenn es danach geht, wo er in der Geburtsfolge stand. Sein Vater war ein katholischer Farmer in Wisconsin und in der Familie wurde der Glauben sehr ernst genommen. Die Schule war im ersten Anlauf nicht so seins, er verließ sie schon mit vierzehn Jahren und erst im Alter von zwanzig drückte eher noch einmal die Schulbank. Dann aber richtig: High-School-Abschluss in Rekordzeit, es folgte ein Jura-Studium. Sieben Jahre später wurde er als Rechtsanwalt zugelassen, und ab 1939 war er Bezirksrichter.
Das nennt man eine Karriere und fragt sich, sobald man den Namen hört, wann dieser Karriere-Typ falsch abbog. Unser noch Unbekannter meldete sich, wie es sich für einen Patrioten ziemt, zum Einsatz im Zweiten Weltkrieg und bekam eine Stelle bei der Air Force. Eingesetzt wurde er als Nachrichtenoffizier. Warum er in die Heimat schrieb, er wäre ein kampferfahrener Heckenschütze, ein sogenannter »Tail-Gunnar Joe«, bleibt sein Geheimnis – aber vielleicht war das die Ecke, an der er zum ersten Mal falsch abbog.
Mit dieser Story in der Tasche bewarb er sich nach dem Krieg als republikanischer Kandidat bei den Vorwahlen zum Senat. Der amtierender Kandidat aus seiner Partei hatte dem nichts entgegenzusetzen, er war schon zu alt. So war es ein Kinderspiel für ihn, die Vorwahlen zu gewinnen. Als Republikaner war es dann ein Kinderspiel die Senatswahl zu gewinnen. Er ging nach Washington.
Der jüngste Senator, zumindest dieser Wahlperiode, machte schnell von sich reden. Bei den Lobbyisten kam er richtig gut an, aber das richtige Thema fehlte dem jungen Politiker noch. Da kam ihm der Kommunismus und die Angst vor ihm gut zu pass.
Die Rede ist von Joseph Raymond McCarthy.
Ich will den Mann nicht verteidigen, das wäre das Letzte, was mir einfiele. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass diese Kampagne keine Erfindung des Mannes aus Wisconsin war. Er sprang auf einen Zug, der schon am Rollen war. 1947 erklärten Schauspieler wie Robert Montgomery, Gary Cooper und Ginger Rogers gegenüber Komitee für unamerikanische Umtriebe, dass Hollywood von Kommunisten unterwandert wäre. Verdächtige fanden sich schnell und wurden geladen. Wer bereit war, auszusagen und andere »Rote« zu nennen, der hatte Chancen davon zukommen. Wer dies nicht tat, wie beispielsweise Dalton Trumbo, der landete auf der sogenannten Schwarzen Liste. Für Schauspieler war das fatal, ihnen blieb entweder der Weg ins Ausland oder sie spielten in der Zukunft am Theater. Drehbuchschreiber wie Trumbo hatten es ein wenig leichter, sie konnten unter Pseudonym weiterarbeiten.
Simenon, der einige Freunde in der Branche hatte, durfte dies nicht entgangen sein, aber bewusst wurde es ihm erst, als er über seine Einbürgerung nachdachte und deshalb schrieb:
Im Frühling 1951, als der Schnee um uns herum schmolz und unsere Bäche sich in Wildbäche verwandelten, erhielt ein gewisser Senator McCarthy vom Senat den Vorsitz einer Kommission, vor der eine große Anzahl von Personen erscheinen musste, die der Subversion angeklagt waren, das heißt Tätigkeiten, die nicht im Interesse des Landes lagen.
Denn 1951 setzte eine zweite Welle ein und vor dieses besondere Komitee wurden weitere Filmschaffende geladen. Dem Prinzip blieb man treu. Von McCarthy war da noch nichts zu sehen. Wo war er?
Der Mann begann seine Kampagne nicht in oder gegen Hollywood, er hatte seinen Blick auf den Regierungsapparat gerichtet. Öffentlich erklärte er im Februar 1950, dass ihm eine Liste vorläge, auf der 205 Personen ständen, die als Mitglieder der Kommunistischen Partei im Außenministerium arbeiten würde. Das hörte sich gewaltig an, das hörte sich nach Gefahr an. Ausgerechnet im Außenministerium, wo die USA doch im Clinch mit Russland und China waren, und in Korea sah es auch nicht besonders lustig aus. Diese Äußerungen stießen auf ein großes Echo, nicht nur in der Politik. Wen scherte es, dass McCarthy eine solche Liste gar nicht hatte? Und wen wundert es, dass fünfundsechzig Jahre ein anderer Politiker auf dem gleichen Instrument spielte und damit Erfolg hatte?
Die Konsequenz war, dass der Senat einen Unterausschuss gründetet, der den schönen Namen »Unterausschuss zur Überprüfung der Staatstreue von Angestellten des Außenministeriums« trug, unter dem Vorsitz eines Demokraten stand und erst einmal bei McCarthy nachfragte, welche Kommunisten er denn auf seiner Liste hätte. Da er keine hatte, konnte er nicht antworten und der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass dies alles Betrug und Schwindel war. Gab es Konsequenzen? Nein, nur war McCarthy nun in aller Munde. Und wie heißt es schon schön: Es gibt keine schlechte Publicity.
Die Präsidentschaftswahlen 1952 wurden vom Republikaner Dwight D. Eisenhower gewonnen. McCarthy wurde wiedergewählt, wenn seine Ergebnisse auch schlechter waren als die bei der Wahl zuvor. Die Partei wollte sich gegenüber dem unermüdlich kämpfenden Mann erkenntlich zeigen und offerierte ihm den Posten eines Senatsausschusses. Möglich wäre auch, dass sie den bulligen Ex-Soldaten einfach ruhig stellen wollte. Anfang des Jahres 1953 übernahm er den Posten des »Government Operations Committee«. Die republikanische Führung war der Meinung, dass er auf dem Posten keinen großen Schaden anrichten könne, hatte aber nicht im Blick gehabt, dass dieser Ausschuss 1952 einen Unterausschuss für Untersuchungen eingerichtet hatte und den hatte McCarthy vor zu nutzen. Er trat in den Wettbewerb mit den Kollegen des Repräsentantenhauses und deren »Komitee für unamerikanische Umtriebe«.
Was nun folgte, beschrieb Simenon, auch wenn er in der Zeit verrutscht war, so:
Im Frühling 1951, als der Schnee um uns herum schmolz und unsere Bäche sich in Wildbäche verwandelten, erhielt ein gewisser Senator McCarthy vom Senat den Vorsitz einer Kommission, vor der eine große Anzahl von Personen erscheinen musste, die der Subversion angeklagt waren, das heißt Tätigkeiten, die nicht im Interesse des Landes lagen.
Er schildert, wie er die Tribunale beispielsweise gegen Oppenheimer verfolgte. Irgendwer denunzierte den Physiker, der an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Er wurde observiert und jedes Wort, was er sprach, jede Meinung, die er vertrat, wurde zu seinem Nachteil ausgelegt. All das Material gelangte dann an McCarthy, der es in seinem Tribunal ausschlachtete. Dabei wurden diese Schauprozesse im Fernsehen und Radio übertragen, sodass es für Simenon kein Problem war, diese jederzeit zu verfolgen. Das war ein typisches Muster für die Vorgänge in der damaligen Zeit.
Ich war von dieser Sache gepackt, und wenn D. und ich aus dem Haus mussten, verfolgten wir die Verhandlungen über das Autoradio. Das war im Frühling und mitten im Sommer, und das gesamte Amerika verfolgte diese Affäre, die die Schlagzeilen der Zeitungen beherrschte.
Große Regisseure aus Hollywood, weltweit berühmte Drehbuchautoren, gestern noch gefeierte Schauspieler tauchten unter. McCarthy verbreitete eine solche Angst, dass all denen die Studios verwehrt wurden, die von der Kommission vorgeladen worden waren oder noch vorgeladen werden konnten.
Mein berühmter Kollege Dashiell Hammett, dem ich zwei Jahre später wiederbegegnen sollte, zog das Gefängnis einem Eid vor, den er für verfassungswidrig hielt.
Nun war es nicht McCarthy, der Hammett ins Gefängnis schickte, weil der sich weigerte auszusagen. Es war der Ausschuss vom Repräsentantenhaus, der Probleme damit hatte, dass der Schriftsteller seine verfassungsgemäßen Rechte in Anspruch nahm. Aber der Schöpfer von Sam Spade hatte das Pech, zwei Jahre später auch noch einmal vor McCarthy antreten zu müssen – eine Befragung, die live im Fernsehen übertragen wurde.
Simenon äußerte sich in seinen Erinnerungen verwundert, wie es zu einer Hexenjagd wie dieser kommen konnte – ausgerechnet in Amerika. Man nenne mich pessimistisch, ich würde es eher als eine realistische Einschätzung sehen: Freiheit, Frieden, Demokratie sind einfach keine Selbstverständlichkeit, nirgendwo. Wie schnell stand der Krieg vor unserer Haustür, obwohl wir nicht unmittelbar betroffen waren? Und das ist keine Anspielung auf den Ukraine-Konflikt, den jüngsten unserer Konflikte. Das Drama hatten wir schon fünfundzwanzig Jahre zuvor auf dem Balkan gehabt. Wir tun so, als bei uns die Demokratie gefestigt ist und niemand ihr etwas anhaben könnte. Ist das nicht ein Trugschluss? Jetzt waren es vielleicht ein paar idiotische Fantasten, die versucht haben, ein »Reich« zu errichten. Beim nächsten Mal sind es vielleicht cleverere Leute, die sich an der Demokratie vergreifen.
Vielmehr könnte man darüber irritiert sein, dass Simenon überrascht war. Hautnah hatte er erlebt, was in Europa in den 20er- und 30er-Jahren passierte. Auch da war es kein Paukenschlag, sondern es kam langsam. Niemand hatte gedacht, dass es so übel werden würde, bis das Übel an der Tagesordnung war. Dieses Muster lässt sich übertragen … in jede Zeit.
In der Situation stellte sich Simenon die Frage, ob er Teil von dem sein wollte. Im Kleinen vielleicht, zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden. Aber sich einbürgern zu lassen, kam für ihn nicht mehr infrage.
Wann diese Erkenntnis in Simenon reifte, ob es ein Prozess war, der sich über Jahre erstreckte, lässt sich anhand dieser Erinnerungen nicht nachvollziehen. Einerseits spricht er von 1951, greift dann aber Ereignisse auf, die sich erst 1953 abgespielt haben.
McCarthy überspannte übrigens den Bogen. Vieles ließ man ihm lange Zeit durchgehen. Sein Problem war aber, dass er agierte, als wäre er in der Opposition und so seine eigenen Parteikollegen, seinen Präsidenten angriff. Der Niedergang begann, als er und seine Clique anfingen, sich mit dem Militär anzulegen. Erst legte er sich mit einem General an und äußerte öffentlich Zweifel an dessen Fähigkeiten – die Armee wurde daraufhin unkooperativ. Dann versuchte ein enger Mitarbeiter McCarthys Einfluss auf die Militärkarriere eines ehemaligen Angestellten zu nehmen.
Ein gefundenes Fressen für die Medien, die das Thema gern aufgriffen. In der Folge wurde ein weiterer Unterausschuss eingerichtet, der den Vorgang untersuchen sollte. McCarthy kam in dessen Fazit nach den Untersuchungen noch einmal davon, seine Mitarbeiter aber nicht. Das war eine Warnung gewesen, aber McCarthy konnte nicht aufhören. In einer Anhörung, öffentlich übertragen, vergriff er sich derart im Ton, dass ihn der Anwalt öffentlich mit den Worten
»Haben Sie denn überhaupt keinen Sinn für Anstand, Sir? Ist bei Ihnen gar kein Sinn für Anstand mehr übrig?«
anging. Alle Welt hörte es. Es war ein Angriff auf seine Integrität, der von den Medien gern aufgegriffen wurde.
Der Fernsehjournalist Edward R. Murrow beschäftigte sich in seiner Fernsehsendung »See It Now« mehrmals mit Untersuchungen von McCarthy und seine Methoden. In letzter Konsequenz kostete ihn das auch Sympathien bei seinen Parteigängern. Anfang 1954 wandte sich Eisenhower von ihm ab. Der Präsident schränkte die Möglichkeiten McCarthys ein, Vorgänge innerhalb der Regierung zu untersuchen ab.
Hilfreich dürfte auch nicht gewesen sein, dass der Mann aus Wisconsin nun seine Hochverratsvorwürfe auch auf die Präsidentschaft Eisenhowers erweiterte und Eisenhower selbst als »verkappten Kommunisten« verdächtigte.
Im Sommer 1954 wurde ein Ausschuss eingesetzt, um die Ausschuss-Aktivitäten McCarthys zu untersuchen. Von vielen Vorwürfen, die untersucht werden sollten, blieb nicht viel übrig oder seine Kollegen mochten McCarthy dafür nicht verurteilen. Der wehrte sich nach Kräften und in seinen Augen handelte es sich um einen Versuch der Kommunisten, ihn mundtot zu machen. So wurde er von dem Ausschuss im Dezember 1954 mit einer großen Mehrheit verurteilt und politisch war er damit tot.
Am 2. Mai 1957 starb Senator Joseph McCarthy in einem Krankenhaus in der Nähe von Washington. Allgemeint wird heute angenommen, dass es Alkoholismus war, der ihn umbrachte.
Die Periode wird »McCarthy-Ära« genannt, aber es gehörte mehr als nur ein Mann dazu, um das Land derart in Unsicherheit zu versetzen. Es begann schon vor McCarthy und in gemilderter Form gingen die Aktivitäten danach auch weiter. Arthur Miller hatte sich in seinem Stück »Hexenjagd« 1953 mit der Stimmung auseinandergesetzt. Drei Jahre später, da war McCarthy von der politischen Bühne so gut wie verschwunden, wurde er von dem Komitee für unamerikanische Umtriebe vorgeladen.
Miller wollte nur seinen Pass verlängert wissen. Vorab liess sich von Francis E. Walter, dem Vorsitzenden des Ausschusses, zusichern, dass er keine Namen nennen müsse – während der Aussage wurde diese Zusage zurückgezogen und da sich Miller weigerte auszusagen, wurde er verurteilt: Geldstrafe, Gefängnis, Schwarze Liste, kein Pass.
Erst zwei Jahre später wurde er von einem ordentlichen Gericht freigesprochen. Allerdings nicht, weil er gezwungen worden war, vor dem Komitee auszusagen. Walter hatte sich nicht an seine Zusagen gehalten und das war nicht rechtens.
McCarthy war ein übler Kerl, er war jedoch nicht der einzige. (Gary Cooper bereute schon Anfang der 50er-Jahre seine anfängliche Intention und setzte sich für Menschen ein, die vor dem Ausschuss landeten und verurteilt wurden. Die Einsicht hatten nicht alle.)
Schluss mit dem Irrsinn
Denyse stellte eine Sekretärin ein, die Simenon in seinen Erinnerungen mit V. abkürzte. Die Leser:innen erfahren, dass die Dame eine noch nicht volljährige Tochter hatte, die in der Nähe studierte und hin und wieder meinte er gesehen zu haben, wie still weinte. Eingemischt oder nachgefragt hatte er nicht, es ging ihn nichts an.
Journalisten interessierten sich weiterhin für ihn und besuchten ihn, manche sogar eine ganze Woche lang. Die großen Berichte, die daraufhin folgten, fielen kleiner aus, als er erwartet hatte. Simenon hatte das Gefühl, dass sie tausend Fotos von ihm geschossen hatte, aber in der Simenon-Reportage, die daraufhin in der »Life« erschien, waren nur sechs von denen zu sehen.
Am Ende des Abschnittes sind wir immer noch im Jahr 1951. Wir werden mitgenommen zu Schulveranstaltungen und zu Picknicks. Das ist das Amerika, welches der Schriftsteller liebte. Das war sein Zuhause. Mochte er auch nicht amerikanischer Staatsbürger werden, so hatte er nicht vor, das Land zu verlassen.
Außer mal kurz, um Mitglied der Akademie zu werden.


 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.