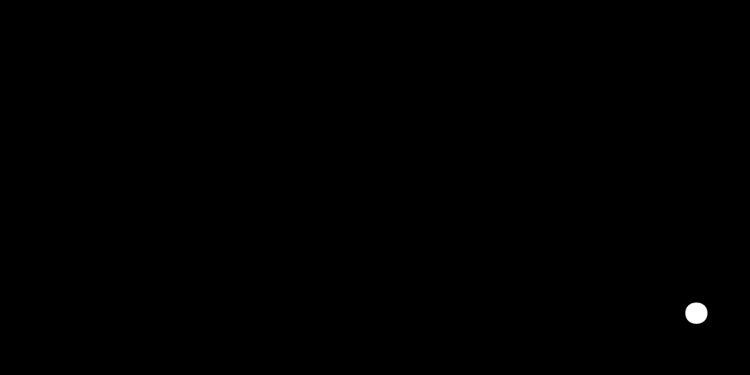
Bildnachweis: Punkt - maigret.de
This bitter earth
Reisen in ferne Länder habe ich gern durch Reisetagebücher begleitet. In Potsdam saß mein Vater und druckte die im Internet verfügbaren Berichte aus und gab sie, nachdem er sie studiert hatte, meiner Mutter zum Lesen. Waren sie auf den Expeditionen dabei, dann machte er das im Anschluss. Vor etwa dreizehn Jahren waren wir zusammen in Südafrika.
Als wir uns ein Weilchen nach der Reise sahen, hatte mein Vater die gesammelten Berichte ausgedruckt und meine Mutter hatte sie auch studiert. Nun habe ich eine lebhafte Fantasie, was meine Eltern durchaus wussten, und sie meinte zu mir: »Also diese Story, dass wir bei der Fahrt nach … an dem Kadaver eines halben Pferdes vorbeigefahren sind. Wie kommst du auf so was?« »Der lag da.« »Nein!« Der Papi war genauso verwundert, denn er hatte das auch nicht gesehen. Aber meine Frau hatte neben mir gesessen und gesehen: »Ja, das halbe Pferd lag da.«
Meine Mutter hatte es nicht leicht und musste ständig prüfen, ob die Geschichten, die ich so erzählte, auch wirklich wahr waren oder nicht. Das ist halt so, wenn man das Kind mit Büchern versorgt und die Fantasie fördert. So etwas kommt dabei rum. Es gilt dann immer auf der Hut zu sein …
An der bewusst gewählten Vergangenheitsform und dem Titel lässt sich erahnen, dass hier keine guten Nachrichten verkündet werden: Dass ich einen solchen Beitrag irgendwann schreiben muss, dieses Unausweichliche war mir bewusst. Nun hatte ich »Punkt« vor wenigen Monaten geschrieben. Es war der Nachruf auf meinen Vater gewesen, der nach langer Krankheit doch irgendwie plötzlich starb. Jetzt ist die Mutter gegangen, die Mami.
Immer wird es Menschen geben, die es schlimmer trifft – aber im Moment, wo wir knapp vier Monate nach dem Abschied von unserem Vater auch die Mutter beweinen, kommen wir uns betrogen vor und enttäuscht, fragen uns, wo die Fairness bleibt, wohlwissend, dass es Gerechtigkeit im Leben nie gibt.
Unterwegs
An Sonnabenden und an Sonntagen wurde gefrühstückt, und das ausgiebig: Da wurde richtig aufgetragen und ein Ei gab es auch. Unter der Woche begnügte sich meine Mutter lange Zeit mit einem Kaffee und der obligatorischen Zigarette. Sie müsse nichts frühstücken, sagte sie immer. Amüsant war jedoch, dass sie das Bedürfnis, etwas zu essen, dann überkam, wenn sie unterwegs war. Stullen wurden geschmiert, manchmal auch Eier noch gekocht. Sobald sich das Reisegefährt, sei es ein Auto, sei es ein Zug gewesen, musste sie die Wegzehrung herausholen und anfangen zu essen.
Ich kann gar nicht sagen, ob sie wirklich viel aß und ob sich das während der Fahrt fortsetzte. Manchmal blieb etwas über und wurde mit nach Hause gebracht. Als verwöhnte Kinder, die wir waren, mochten wir es gern frisch. Aber die von der Reise mitgebrachten Stullen hatten so etwas bekommen, was einer Äquatortaufe gleicht und damit auch einen Titel: »Hasenbrote«. Die aßen wir besonders gern, denn die mussten was Besonderes sein. Egal, von welchem Besuch sie kamen, auf das Reise-Proviant waren wir immer scharf. So, als würde das anders schmecken.
Sie reiste gern, wie mein Vater, aber ich kann nicht genau sagen, was für sie das Reisen ausmachte: Wenn sie von ihnen erzählte, dann meist von den Menschen, die sie getroffen hatte. Es blieb dem Papa überlassen, zu erzählen, was sie alles gesehen hatten, und er arbeitete die Touren auf. Von unseren Afrika-Reisen wussten wir, dass sie ein Faible für Affen hatte. Den konnte sie lange zusehen und sich an ihrem Trollen ergötzen. Das mit den anderen Tieren war auch schön, aber die Affen war das für sie das Schönste.
In Vietnam war ihre größte Sorge, uns könnte Hundefleisch serviert werden. Das wollte sie nicht essen und führte dazu auch eine denkwürdige Konversation mit unserem Reiseführer. Seine Versuche, sie zu beruhigen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Das mochte daran gelegen haben, dass er davon sprach, dass man nicht die eigenen Hunde essen würde, sondern die vom Nachbarn.
Wo es ging, verteilten wir auf dieser Reise unsere Bonbons an Kinder. Man stelle sich das hierzulande vor, dass Fremde an Kinder Süßigkeiten verschenken würde. Aber dort, wie auch in Afrika, war es gang und gäbe. Uns ist es nur einmal passiert, dass wir »Out of Sweeties« liefen – da verteilte meine Mutter Eukalyptus-Bonbons, die sie immer dabei hatte. Und in Namibia beglückte sie Dorf-Kinder mit Marzipan.
Zu Hause
Die Sonne war ihr Feind. Zumindest, wenn sie zu Hause war. Dann knallte sie durch die Fenster und jedes Staubkorn war auf der Anbauwand zu sehen. Das war meiner Mutter ein Graus. Ich denke, sie war jeden Tag unterwegs und mit Staub wischen beschäftigt. Wenn es nicht der kleine fiese Dreck war, dann berichtete sie, dass die Fenster nicht sauber wären. Wie oft bekam ich zu hören, dass sie gerade die Scheiben gemacht hätte und es dann geregnet hätte. Unzählige Male.
Überall lagen diese Deckchen. Auf denen standen Vasen mit Blumen oder Schüsseln, in denen entweder Obst oder Nüsse oder Süßigkeiten zu finden waren – manchmal auch kombiniert.
Um zwölf Uhr gab es Mittag. Jeden Tag. Es wäre möglich gewesen, die Uhr danach zu stellen. Die Präzision war erstaunlich. Sie sagte, dass das Backen nicht das ihre wäre (obwohl wir uns wirklich nicht beklagen konnten), aber Kochen mochte sie. Sie hatte unzählige Kochbücher und probierte auch immer wieder Sachen aus. Ich bin, was Oma-und-Mama-Gerichte angeht, sehr konservativ: Ihren bunten Hackbraten, den sie einmal mit Gemüse anreicherte, waren genauso wenig meines, wie Kartoffelsalate mit Wurst und Fisch. Was schon ausgezeichnet ist, kann man nicht besser machen. Das galt auch für Variationen von Kartoffelsuppe. Deshalb bekam die »richtige« Kartoffelsuppe auch einen Namen: »Wahrhaftige Kartoffelsuppe« (den Namen gab ihr mein Vater).
Niemand kannte unsere Marotten besser als unsere Mutter: Ich mochte (und mag) keine zerkochten Erbsen – beim klassischen Mischgemüse ein großes Manko. Weshalb sie in das Mischgemüse extra-große Möhrenstücke machte, die ich dann essen konnte. Nachdem ich die Erbsen heuaussortiert hatte. Wir Kinder mochten kein Lungenhaschee, die Eltern schon – aber noch weniger mochten wir Lungenhaschee mit Gewürzgurken. Also bekamen wir unsere Portionen ohne zubereitet. Ein Kompromiss, mit dem wir alle leben konnten. Legendär ist Erbspüree-Vorfall: Mein Schwesterchen liebte Erbsen, ich mochte sie überhaupt nicht, beide mochten wir kein Erbspüree. Meine Mutter probierte es an einem Sonnabend trotzdem und wir weigerten uns. Daraufhin sprach sie eine Woche nicht mit uns (oder nur das Notwendigste). Darüber Lachen konnte sie erst viel, viel später.
Waren wir im Ausland, kam unweigerlich der Tag, an dem sie sagte: »Jetzt mal eine richtige Schwarzbrotstulle.« Meist war es der dritte Tag und das Hasenbrot war schon lange aufgegessen.
Musik
Gleichzeitig singen und ein Instrument spielen – das konnte sie. Sie spielte Akkordeon und Klavier, nicht klassische Stücke. Vielmehr die Lieder, zu denen es sich schunkeln und klatschen ließ. »Eine Seefahrt, die ist lustig …« gehörte dazu, dieses Lied, in dem die Singvögel aufgezählt werden und das Lied, in dem das Lernen der Wochentage mit Sportunterricht verbunden wurde: »Laurentia, liebe Laurentia, mein«.
Mit diesen Liedern verbinde ich ihre Arbeit – fünfundzwanzig Jahre hatte meine Mutter in Einrichtungen gearbeitet, in denen Kinder mit Down-Syndrom betreut wurden, aber auch Kinder mit anderen geistigen Einschränkungen und diese kombiniert mit körperlichen Handicaps.
Ich bin überzeugt, dass dies eine anstrengende Tätigkeit gewesen ist. Sie brachte aber auch praktische Vorteile mit sich. Zu DDR-Zeiten war es so wie heute beim Playstation 5-Kauf: Es ist gut, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mit den Kindern wurde viel spazieren gegangen und da sich in unmittelbarer Umgebung der Einrichtung die Potsdamer Innenstadt befand, ergaben sich Gelegenheiten, über gute Sachen hinzuzukommen. Auch ließ sich ein Teil der obligatorischen Besorgungen während dieser Zeit erledigen.
Wir sind mit diesen Kindern und ihren Geschichten aufgewachsen. Bei Feiern in dieser Einrichtung waren wir auch mit dabei, beispielsweise Fasching. In den Ferien sind wir mit Spazieren gegangen. Es war wie ein Teil unserer Familie. Viele Jahre bin ich vor meinem Klavierunterricht noch mal bei meiner Mutter vorbeigegangen. In deren Sportsaal stand ein Klavier und da habe ich geübt, bevor ich zu meinem unmöglichen Klavierlehrer gegangen war, der ein paar Straßen etwas betrieb, was man heute als Fast Music Education bezeichnen würde. Mit Ausbildung hatte es, genau genommen, nichts zu tun.
Kinder reiben sich einerseits am Musik-Geschmack der Eltern, sie nehmen oft auch etwas mit. Die Schlager-Schiene und ein Teil ihrer Rock 'n Roll-Vorlieben waren nicht meines. Dafür höre ich aber immer noch gern Neil Diamond.
In Erinnerung ist mir, wie wir nach dem Erwerb einer AMIGA-Platte von den Smokies wie wild zu »Living Next Door to Alice« tanzten. Zur ebenfalls erworbenen Roger Whittaker-Platte wurde nicht getanzt.
Sie haben bisher keine Genehmigung für die Darstellung von YouTube-Video-Material erteilt. Dies kann über die Cookie-Verwaltung erfolgen.
Opposition
Sie war die Tochter eines Kaufmanns. Mein Opa hatte einen kleinen Kolonialwaren-Laden gehabt, der im Krieg zerstört worden war. Die Herkunft sorgte in der DDR dafür, dass sie nach der achten Klasse abzugehen hatte. Sie begann eine Lehre in einem Fotogeschäft, aber es war schnell absehbar, dass sie damit nicht glücklich werden würde. Also machte sie eine Weiterbildung zur Unterstufenlehrerin, später qualifizierte sie sich für Sonderpädagogik.
Wenn ihr etwas nicht gefiel oder sie sich an etwas rieb, dann wählte sie den DDR-Weg der Beschwerde: die Eingabe.
In der Familie wurde viel über Politik diskutiert. Mein Vater war für den Sozialismus, meine Mutter war sehr reserviert – um es vorsichtig zu formulieren. Die Wende empfand sie als großen Glücksfall. Mit dem, was danach kam, war sie weniger einverstanden. Wenn ich sie darauf hinwies, dass sie ein gutes Leben führen würde, meinte sie: »Ja, uns geht es gut. Aber schau mal die anderen an.« Nach der Wende nährte sie politisch meinem Vater an, eine interessante Entwicklung. Wobei hinzuzufügen ist, dass beide realistisch genug waren, zu erkennen, dass es so, wie es in der DDR war, nicht weitergehen konnte. Auch mein Vater hatte die Wende begrüßt, seine Ideale blieben.
Auf den Stolpe ließen sie nichts kommen …
Die Prägung
Klar, diese Seite würde nicht existieren, wenn es meine Mutter nicht gäbe: Dafür sprechen schon biologische Gründe. Es gibt jedoch auch sekundäre Aspekte, die noch eine Rolle spielen. Meine Mutter mochte die Maigret-Verfilmungen mit Jean Richard und ich schaute sie mir gemeinsam mit ihr an. Wie viele es gewesen sind? Keine Ahnung, aber in einer Zeit, in der ich nicht das Fernsehprogramm bestimmen durfte, setzte sie diese Prägung.
Als ich später anfing, die Maigrets zu lesen, war sie mit dabei. Hatte ich einen Maigret ausgelesen, brachte ich ihn ihr mit. So wie ich hatte sie jeden einzelnen Maigret-Roman mindestens einmal gelesen. Hin und wieder brachte ich ihr auch die Non-Maigrets mit, aber immer nur die nicht ganz düsteren: »Brief an meine Mutter«, »Der kleine Heilige« zuletzt noch »Die Komplizen«.
Diesen Drang, Sachen zu sammeln, den habe ich definitiv von ihr: Sie sammelte Rezepte, Autogramme und Ansichtskarten. Sie hob ganz viel Erinnerungen an uns auf, die wir nun alle wiedergefunden haben.
Menschen jenseits der achtzig haben immer irgendwas und kerngesund sind die wenigsten. Dass die Mami dem Papi so schnell folgte, das hätten wir im Leben nicht gedacht.
Wir stehen mit einer ganzen Reihe von Fragen da, auch mit ein wenig Wut im Bauch. Aber nicht auf die Mami.
Gemeinsam mit unserem Papi ermöglichte sie uns eine glückliche Kindheit, war Begleiterin und Ratgeberin in unserem Erwachsenenleben, nahm stets Anteil an unserem Leben. Wir hätten es nicht besser treffen können.
Noch können wir es nicht begreifen, ihr Ableben scheint nicht real.
Die Mami ist am 30. Juni gestorben.
Karin Hahn – 1940-2022


 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.