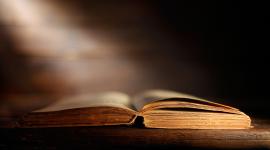Bildnachweis: Die anderen Detektive - maigret.de / LeonardoAI
Die anderen Detektive
Denkt man an Simenon, so hat man sofort Maigret im Kopf. Aber Maigret war nicht der einzige Polizist (Ermittler), der der Feder Simenons entsprungen ist. Der kleine Doktor hat es in eine Fernsehserie geschafft und auch den Anderen sollte man eine Chance geben.
G7
2018 erschien der erste Band mit Geschichten von G 7 in deutscher Sprache bei Kampa. Bei diesem Detektiv handelt es sich anfangs um einen Kommissar des Quai des Orfèvres. Vom Erzähler, der die Geschichten durchweg begleitet, wird er als dreißigjähriger Mann geschildert, der mehr wie ein Rathausscheiber oder Bürovorsteher wirkt. Dieser G 7 war ein schüchterner Typ, der sich nicht in den Vordergrund spielte und den man deshalb eher unterschätzte. Dazu kam, dass er sich dezent und langweilig kleidete.
Mit »Die Irre von Itteville« hatte Simenon seinerzeit etwas Neues ausprobiert: Die Kombination von Fotografie und Text als Roman. Dieser Fotoroman schlug jedoch nicht so ein, wie erhofft und so bekommen die Leser hierzulande auch erst einmal nur den Text geboten. In Itteville radelte der Posthalter Tabarot regelmäßig nach Ballancourt, doch an jenem Tag entdeckte er bei stürmischem Wetter eine fremde Szene an der »Kreuzung zum Toten Hengst«. Eine junge Frau behauptete, es gäbe einen Mord. Tabarot fand Dr. Canut leblos vor, doch als er mit der Polizei zurückkehrte, war ein anderer Leichnam dort, welches sein Verständnis herausforderte. G7 kam zur Hilfe. Der Ermordete war nicht der Doktor, denn dieser befand sich wohlauf in seiner Klinik und verneinte jegliches Wissen um die Vorfälle, obwohl er sowohl die Kreuzung und die junge Frau kannte. Mit einem Alibi für die nahegelegene Geburtshilfe schien er unberührbar. G7 wollte die Leiche begutachten, doch sie war verschwunden. So wandte er sich der Hauptzeugin zu: der verrückten Frau von Itteville. Und der Kommissar feierte einen gelungenen Einstand.
Die zweite Erzählung »Auf Grand Langoustier« führt die Leser:innen auf die Insel Porquerolles: Innerhalb einer Woche waren drei Frauen verschwunden, ohne dass sich die Bootsleute an ihre Abreise erinnern konnten. Die Möglichkeit, dass sie die Insel verlassen hatten, hielt die örtliche Polizei für unwahrscheinlich. Da die Tourismussaison bevorstand, war es dringend notwendig, den Fall zu lösen. Daher wurden G7 und sein Kompagnon auf die Insel gesandt, um schnellstmöglich Aufklärung zu schaffen. Simenon hatte die Insel zu einem seiner Lieblingsorten erklärt und so reiht sich die Geschichte in eine ganze Reihe ein, die auf dem Eiland spielt.
Mindestens ein Jahr nach den Ereignissen auf Porquerolles, erhält die Pariser Kriminalpolizei ein ominöses Schreiben, das einen Mord ankündigt. Der Chef der Kriminalpolizei überträgt den Fall an G7 mit der Bitte, alles Erforderliche zu unternehmen, um den Mord zu verhindern. Der Kommissar versteht diesen Hinweis als Anweisung, den Mord zu vereiteln und begibt sich mit einem Freund zum angekündigten Tatort, einem Vorort von Paris.
Das mutmaßliche Opfer, Morozow, ein allein lebender, älterer Emigrant aus Russland, verbringt den Abend in einem nahegelegenen Restaurant. Der Kommissar durchkämmt sein Haus, findet aber nichts Auffälliges. Die Nacht bricht mit ungemütlichem Wetter herein, das eher an Herbst als an Frühling erinnert. Die Beobachter müssen durch den Regen ausharren; die Sicht ist schlecht. Der Erzähler gesteht, dass er während der nächtlichen Überwachung für sieben Minuten eingenickt ist – ein entscheidender Zeitraum, der im Nachhinein die Bedeutung für den Fall erlangt. Und auch titelgebend ist – »Siebenminutennacht«. Am nächsten Morgen trifft die Gruppe eine erschütternde Entdeckung: Morozow wurde in der Nacht erschossen, obwohl die Beobachter – abgesehen von diesen sieben Minuten – keine verdächtigen Vorkommnisse bemerkt hatten.
Der erste Band mit Geschichten um G7 trägt als Titel den Namen der vierten und in letzten Erzählung – »Das Rätsel der Maria Galanda«. In dieser ist G7 schon nicht mehr als Kommissar angestellt – die Affäre aus der vorherigen Geschichte hatte wohl seinen Tribut in Form seines Postens gefordert. Der Reeder Morineau musste kürzlich einen herben Verlust hinnehmen: Eines seiner stillgelegten Schiffe wurde aus dem Hafen von Fécamp entwendet. Wenig später trieb es herrenlos im Kanal, von der Crew fehlte jede Spur. Bei der Überprüfung des Schiffs bemerkte der Techniker der Reederei zwei besondere Dinge: Der Motor war fachkundig überarbeitet worden, was ihn sichtlich beeindruckte. Der zweite Punkt war jedoch höchst eigenartig. Beim Abklopfen des Wassertanks, der seltsamerweise nicht gefüllt war, bemerkte er, dass etwas mit dem Inhalt nicht stimmte. Nach dem Ausbau und Öffnen des Tanks fand man neben Wasser unerwartet eine Frauenleiche. Für Morineau war die Angelegenheit äußerst unangenehm. Die Bergung des Schiffs hatte ihn viel Geld gekostet, das er von den Dieben zurückfordern wollte. Der Mord wart eigentlich zweitrangig.
Es gibt noch weitere Erzählungen, aber diese werden in deutscher Sprache aber erst im Laufe des Jahres 2025 erscheinen.
Der kleine Doktor
Doktor Jean Dollent ist klein und unauffällig. Dieser ganz andere Typus des Verbrecherjägers ist schon fast als Persiflage auf Maigret zu verstehen. Die Fälle des Landarztes, dessen Markenzeichen sein tuckerndes Auto und seine Liebenswürdigkeit sind, haben ein gewisses Augenzwinkern, denn immer ist der kleine Doktor den professionellen Kollegen ein Schritt voraus. Das wäre etwas, was Kommissar Maigret ordentlich nerven würde...
Die Erzählungen entstanden 1938, einer sehr kreativen Zeit Simenons, in der auch viele Maigret-Kurzgeschichten entstanden sind (zum Beispiel »Herr Montag«). Diogenes veröffentlichte die Geschichten in zwei Bänden, Kampa handhabt es ähnlich. Im Original erschienen die Geschichten in einem Band.
Eine etwas engere Bekanntschaft mit dem sympathischen Hobby-Detektiv können Sie in der Erzählung »Der Spürsinn des kleinen Doktor« schließen. Dort wird einmal ein Vergleich zu dem Übervater der Polizisten gezogen (immer wieder trifft man Spuren im Web, werden neuere Krimi-Detektiv-Charaktere mit Kommissar Maigret verglichen. Eigentlich auch sehr interessant: warum nicht mit Sherlock Holmes, der doch ungemein penibler war. Vielleicht eine Sache der Väterlichkeit und Gerechtigkeit, die man dem Kommissar nachsagt?). Er wird zu einem abgelegenen Haus gerufen und findet dort ein Grab, welches dort nicht hingehört. Die Polizei, von ihm gerufen, kommt, aber in dem kleinen Doktor ist der Spürsinn eines Detektivs geweckt worden, und er möchte diesen Fall lösen.
So muss man sich nicht wundern, dass ihm die Fälle in der Folgen zufallen: wie zum Beispiel der Fall mit der »Das Mädchen in Hellblau«, die ihm den Urlaub versüßt und die Hartnäckigkeit des Rothaarigen, der ihn in »Die Spur des Rothaarigen« bekniet, behilflich zu sein.
Die Erzählung »Der Tote, der vom Himmel fiel« beschert dem kleinen Doktor den Auftrag einer resoluten jungen Frau, die vermutet, dass der Tote, der im Garten ihrer Adoptiveltern landete, nicht vom Himmel fiel, auch wenn es den Anschein hatte, sondern dass der Mann ihr leiblicher Vater ist und von ihrem Adoptivvater umgebracht wurde. In der Erzählung »Das Schloß der roten Hunde« kommt das Verbrechen nicht zu Jean Dollent, wie es vorherigen Erzählungen üblich war, sondern er sucht einen Hauptverdächtigen aus reiner Neugier auf und untersucht den Fall. Zu dem wäre da noch der Fall in einem Pariser Kaufhaus, in dem ein Mann beim Pantoffelanprobieren ermordet wurde – die Kaufhausleitung möchte einen Privatdetektiv haben, der sich um den Mord an dem Pantoffelliebhaber kümmert. Lucas empfiehlt Dollent.
Holzbirne
Manchmal sind die Titel, die Simenon gewählt hat, wirklich sehr vielversprechend. Ich wusste aber nicht, was ich von einer Erzählung mit dem Titel »Der Krüppel mit der Holzbirne« zu halten hatte. Sie erwies sich als sehr unterhaltsam. Titelheld ist Justin Duclos, ein Ex-Kommissar der Pariser Polizei, den es kurz vor dem Ende der Dienstzeit (oder kurz danach) böse erwischt hatte, und der seitdem im Rollstuhl saß.
Er war aber sehr fit und konnte wie Nero Wolf seine Fälle aus dem Stuhl heraus lösen. Zur Seite standen ihm dabei seine Adoptivtochter und, natürlich rein inoffiziell, die ihm zu Füßen liegende Pariser Polizei. In der Erzählung »Die Sängerin von der Pigalle« versucht sich die Adoptivtochter von Jean Duclos als Ermittlerin, assistiert von dem uns wohl bekannten Lapointe.
Die Typen von der Agentur
Mitten in seinem ersten »offiziellen« Auftritt verstirbt der tollpatschig wirkende Inspektor Torrence in »Maigret und Pietr der Lette«[MPL]. Ein Verlust, den Simenon offenbar bereute, denn er erweckte ihn gleich zweimal wieder zum Leben. Zum einen durfte er in späteren Maigret-Fällen wieder unterstützen. Außerdem erhielt er eine Paraderolle in den Geschichten um die Agentur O. Während sich in den Fällen um den großen Kommissar das ungelenke Verhalten von Torrence legte, schien er es bei bei seiner Arbeit als Privatdetektiv nicht abgelegt zu haben.
Hier ist er lustigerweise zwar das Gesicht der Firma, jedoch nicht die Führungspersönlichkeit. Torrence ist bei der Kriminalpolizei ausgeschieden, hatte aber die richtigen Kontakte dorthin und sein Name war bekannt. Weniger prominent war dagegen Émile – er war der Besitzer der Agentur und wirklich ein helles Köpfchen. Als Leser:innnen dürfen wir hierzulande den Detektiven bei sechs Fällen folgen – weitere Fälle könnten in Vorbereitung sein, in deutscher Sprache bisher aber nicht erschienen.
Die Geschichten sind uns sehr lange vorenthalten geblieben. Eine Ausnahme bildet dabei die Story »Der Mann hinter dem Spiegel«, die in den 1980er-Jahren erstmals erschien. Bei dieser handelte es sich um die Erste in dem Agence-Zyklus. Torrence bekam Besuch von einer neuen Klientin, die ihm von ihrem bald eintreffenden Vater berichtete und darum bat, einige Dokumente im Tresor seiner Agentur zu verwahren. Gutmütig willigte Torrence ein. Bei der Gelegenheit wurde ein Taschentuch entwendet – nicht irgendeins, sondern das einzige Beweisstück in einem Fall schweren Raubes, das die Detektive mühsam gesichert hatten. Die Klientin hatte geschickt einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht, und Torrence fiel darauf herein, sehr zum Ärgernis der Detektei.
Die weiteren Geschichten: An einem Morgen erhielt sie in der Agentur einen dringenden Anruf von einer Frau, die sie inständig bat, zu ihr zu kommen, da sie eine Leiche im »Schuppen am Teich« entdeckt hatte und weder die Polizei noch ihren Mann informieren konnte. Ohne direkte Anschuldigungen zu machen, vermittelte ihr Verhalten den Eindruck, dass ihr Mann für den Tod von Jean Marchons verantwortlich sein könnte. Sie beschrieb den Ort als »Maison du Lac« bei Ingrannes im Wald von Orléans. Über die Namen ließ sich streiten. Womit wir beim nackten Mann wären – der kleine, dicke Mann mit dem markanten Bart, der nackt in einer Reihe von Gefangenen stand, fiel Torrence ins Auge, weil er ihm bekannt vorkam, obwohl der Bart kaum noch vorhanden war. Simenon nutzt sein Detailwissen über polizeiliche Praktiken, um die Situationen in der Präfektur zu schildern, wobei bestimmte Tage für Razzien vorgesehen waren. Trotz seiner Ähnlichkeit konnte Torrence, der zu Besuch am Quai war, jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob er den Mann als alten »Kunden« kannte. Aber der Mann erkannte ihn und die Agentur hatte einen neuen Fall.
Ein alter Bekannter wird uns auch in dem Fall um die Verhaftung des Musikers präsentiert: Kommissar Lucas. In Paris lebte der reiche Amerikaner »Onkel John«, der beim Verlassen einer Bar ermordet und ausgeraubt wurde, woraufhin die Polizei den Musiker Joseph Leborgne verdächtigte. Leborgne, der von den bevorstehenden Maßnahmen der Sicherheitskräfte erfuhr, bat seinen Bekannten Torrence um Hilfe. Torrence, skeptisch gegenüber der Situation, schlug vor, dass Leborgne und seine Freundin die Wohnung nach verdächtigen Hinweisen durchsuchen sollten, während er selbst mit seinem Kollegen Émile in die Bar ging, um die Lage weiter zu analysieren. Lucas war nur mäßig begeistert von der Einmischung von privater Seite.
In der malerischen Umgebung von Moret bei Fontainebleau ereigneten sich rätselhafte Morde in zwei benachbarten Gasthöfen am Ufer der Loing, die Scharen von Menschen anzogen, darunter auch Freizeit-Detektive. Zwei alte Männer wurden jeweils in Zimmer 9 ermordet aufgefunden, beide hatten sich als Raphaël Parain aus Carcassonne ausgegeben, obwohl sie sich kaum ähnelten. Torrence und Émile reisten neugierig an den Tatort, fanden jedoch keine freie Unterkunft und wurden wenig herzlich von den Kriminalinspektoren empfangen. Wer sollte den Würger zuerst finden? Und die letzte Story dreht sich um Büro-Material, also um einen Drehbleistift. Émile lässt Torrence in dem Glauben, dass er nur ein einfacher Angestellter sei, während er geschickt die Fäden zieht und mit seinem Spiel den Staatsdienern auf die Füße tritt. Bei einem Cafébesuch fällt Émile durch das Klackern der Absätze einer Frau ein Morsecode auf, der ihm eine Adresse verrät, was sein Interesse weckt und ihn dazu bewegt, der Frau unauffällig zu folgen. Als die Frau über die Metro entkommt, setzt Émile die Verfolgung fort. Bei der Geschichte namens »Der alte Mann mit dem Drehbleistift«.
Zumindest die Fälle aus dem ersten Band machten einen vergnüglichen Eindruck und zeigen Simenon von seiner leichten Seite.
Der Richter
Untypisch in dieser Zusammenfassung scheint Richter Froget zu sein. Letztlich agiert er nicht anders als die Detektiv. Die 13er-Reihe – von denen es insgesamt drei gibt – ist hierzulande nicht allzu bekannt. Simenon konzipierte sie so, dass in einer Woche ein Fall geschildert wurde und in der nächsten Ausgabe gab es eine nicht nur eine neue Fall-Story, sondern auch die Auflösung. Die Geschichten aus dem Band »Der Richter und die 13 Schuldigen«, der 2024 bei Kampa erschienen ist, hat das derart gelöst, dass des Rätsels Lösung nahtlos in die Geschichte integriert war. Leser:innen, die um dieses Konstrukt nicht wussten, konnten es nicht mitbekommen. Vielleicht wunderte sich der eine oder andere, dass die Auflösung am Ende ein wenig abrupt erfolgte und es kein Nachspiel gab, wie Simenon es manchmal in anderen Geschichten handhabte.
In dem Band wird auch keine Erklärung gegeben, warum es dreizehn Schuldige sein sollen, aber vierzehn Fälle sind. Das lag daran, dass nach der Veröffentlichung des Originalbandes Simenon noch mal eine Geschichte nachschob – die letzte in der Aufzählung hier – und somit der Titel nicht mehr aufging. Warum man bei der Veröffentlichung bei Kampa sich nicht Spaß machte, den Buchtitel anzupassen, kann ich nicht sagen.
Gegenüber dem Richter erschien der Ziliouk zunächst wie ein Schwätzer. Bei genauerer Betrachtung erwies sich diese Einschätzung jedoch als relativ. Sowohl der eine als auch der andere sagten wenig. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das, was in den Akten verzeichnet ist, und was Untersuchungsrichter Froget, der hier seinen ersten großen Fall bearbeitet, daraus interpretiert. Sein Gegenüber hofft indessen, dass er nicht allzu viel zwischen den Zeilen liest. Mit Monsieur Rodrigues hatte Richter Froget einen Verdächtigen, der aus der besseren Gesellschaft kam. Dieser war gut alimentiert und schien finanziell nicht in Nöten zu sein. Der Untersuchungsrichter merkte, dass sein Verdächtiger ziemlich herablassend und arrogant war. Froget ließ sich davon nicht beeindrucken, er wirkte sogar gleichgültig. Schließlich ging es um die Aufklärung eines Mordes und da sollte der gesellschaftliche Status keine Rolle spielen. Der besondere Aspekte sollte eine Rolle spielen. Madame Smitt wurde zu einem Fall für den Richter, weil man einen toten Hund in ihrem Garten fand. Sie konnte sich nicht darum kümmern, da sie erkrankt war. Also machte das einer ihrer Pensionsgäste, ein wahrlich netter Mann. Als er nun im Garten ein Grab für das verstorbene Tier grub, stieß er auf Knochenreste. Nicht die eines Tieres, sondern die eines Menschen. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen Mann handelte und dass er mindestens fünf Jahre dort gelegen hatte. Richter Froget stattete der kranken Wirtin ein Besuch ab und kümmerte sich um Aufklärung.
Zwei bärtige Männer, einige Frauen, dazu eine Reihe von Kindern, ländlich lebend, Ausländer, von Luxus keine Spur – wer würde hier einsteigen und einen etwa siebzigjährigen Mann, der so krank ist, dass er noch ein bis zwei Tage zu leben hat, den Schädel mit zahllosen Schlägen einschlagen? Diese Frage darf sich Richter Froget stellen und offenbar ist er nicht zu dem Schluss gekommen, in die weite Ferne zu schweifen. Er sucht den Täter in den Reihen der Mitbewohner – die alle Flamen waren. Dagegen hatte man es bei Nouchi mit Ungarn zu tun. Diese Geschichte macht in vielerlei Hinsicht Spaß: Erst einmal ist sie gut geschrieben. Zudem kommt, dass man mit der Hauptbeschuldigten in diesem Fall Sympathien hat und den Eindruck hat, dass dies auch Richter Froget gleichermaßen empfindet. Hinzu kommt eine Meta-Ebene: Die Verdächtige trägt den Namen Nouchi und ihr Freund – wirklich nur ihr Freund, wie sie betont – heißt Siveschi. Die Kombination der Namen trifft man in dem Roman »Maigret verliert eine Verehrerin«. Was für ein Vergnügen! Der nächste Fall war dann von einem anderen Kaliber: Schon die Schilderung des Aussehens sind nicht darauf ausgelegt, den Verdächtigen sympathisch zu finden. Deutlich zu spüren ist auch, dass Richter Froget keine Sympathien für den Arnold Schuttringer hegte, den er verdächtigte, eine Frau umgebracht zu haben. Das ist eingebettet in eine Affäre, bei der es zudem einen hocheifersüchtigen Ehemann gibt. Und überhaupt ist die Frage erlaubt, warum der verdächtige Arnold Schuttringer seine Geliebte überhaupt hätte umbringen sollen. Das wäre nur zu seinem Nachteil …
Was für einen hochgestellten Beschuldigten hatte sich Richter Froget in diesem Fall geholt. Diese Frage werden sich die Leser:innen stellen und wahrscheinlich sehr beeindruckt sein. Der gute Waldemar Strvzeski versuchte noch dem Untersuchungsrichter die Aussprache seines Namens beizubringen, aber der hatte überhaupt kein Interesse. Er säubert mit jeder weiteren Frage erst die Biografie des gebürtigen Polen, bevor er sich von einem Verbrechen zum nächsten vorarbeitet. Ein Schauspiel! Dagegen schien Philippe ein Weichei zu sein. Dessen Mentor und/oder Lebenspartner hatte sich ein wenig Spaß mit einer gekauften Mätresse gegönnt, es mal so richtig krachen lassen. Für Jules-Raymond-Claude Forestier war das wie Urlaub, denn diese Ausflüge in die Rotlicht-Viertel konnten ein paar Tage dauern. Diesmal war es eine kurze Ausflug, denn der Alptraum einer jeden Prostituierten trat ein – ihr Klient verstarb. Ob das nun in einer Betätigung- oder einer Ruhephase geschah, wird nicht beschrieben. Am Ende war der gute Mann tot. Und Froget nahm sich mal Philippe vor.
Nicolas ist ein Name, den man in Erzählungen von Simenon immer mal wieder antrifft. In diesem Fall hatte Nicolas es mit einem reichem Amerikaner zu tun, der glaube, durchschaut zu haben, dass er als Ausländer in Paris sicher abgezockt werden würde. Deshalb kam er auf die Idee, Nicolas als Guide zu engagieren. Der sollte alle Transaktionen für ihn abwickeln und war vorneweg von ihm auch entsprechend alimentiert worden. Am Ende des Tages hatte er eine Kopfwunde, da ihm der Nicolas eine Flasche über den Kopf gezogen hatte. Die erstattete Anzeige wegen Raub und versuchten Mordes untersuchte Richter Froget bei einem Ortstermin. Die Timmermans waren Artisten und ihre Nummern, die es in einem Zirkus aufführten, waren unter aller Kanone. Sie wurden von dem Publikum nicht gut aufgenommen und die Zirkusbetreiber nahmen sie nur als Lückenfüller mit. Die Timmermans wurden schlecht bezahlt und hatten noch andere Aufgaben im laufenden Betrieb zu erledigen. Das Ehepaar hatte einen anderen Status als beispielsweise Jack Lieb, dessen Nummer gut ankam, besser bezahlt war und auf dieses Engagement nicht angewiesen war. Nur war er irgendwann tot und die Timmermanns saßen vor dem Richter. Wie auch der Pascha. Untersuchungsrichter Froget hatte schon die Ahnung, dass es schwer werden würde. Der Staatsanwalt hatte ihm gesagt, dass, wenn er den Mann nicht knacken würde, die Akten zu dem Fall geschlossen würden. Sein Gegenüber, ein reicher und weltgewandter Mann, war für seine Cleverness bekannt. Allerdings redeten auch manche darüber, dass er unbeherrscht und gewalttätig sein konnte. Das war der Grund, warum er vor Froget saß: Der Pascha, wie man ihn nannte, war des Mordes verdächtig.
Die letzten Jahre waren nicht sehr gut gelaufen für Otto Müller. Der Mann, dem ein gewisser Erfindergeist nicht abzusprechen war, hatte keinen geschäftlichen Erfolg mehr. Und so entschloss er sich, seine Frau zurück in Emden zu lassen, und nach Paris zu gehen, um dort an alte Erfolge anzuschließen. Allerdings schien er nicht mit einer zündenden Idee gekommen zu sein. Oder sein grandioser Plan war es, sich in die Welt des Verbrechens zu stürzen. Nun saß er vor Froget, kein gutes Zeichen. Den lustigsten Namen in der Reihe hatte nicht Nouchi. Ich finde Bus ist noch viel besser. Allerdings waren seine Verbrechen selbst für das Simenon-Universum ziemlich einmalig. Fünf, vielleicht auch sechs Erschossene ging auf das Konto eines Mannes, der schlicht und ergreifend Bus genannt wurde. Ein komischer Name für jemanden, der von heute auf morgen zu einem mehrfachen Mörder wurde und dessen Motiv nur ein Streit gewesen sein soll. Ziemlich überreagiert, würde man sagen. Richter Froget hatte das zu interessieren, weil der besagte Mann mit dem Schiff nach Frankreich kam. Der Band endet mit der »Nacht am Pont Marie«. Es war eine neblige Nacht an der Seine. Zwei Polizisten wurden von einer hysterisch wirkenden Frau angesprochen, die behauptete, sie hätte einen Mann umgebracht. Gefunden wurde die Leiche nicht, die Frau kommt auf die Wache. Am nächsten Morgen erklärte sie den Beamten, das wäre ein Streich gewesen, niemand wäre gekillt worden und wollte Hause. Statt schenkelklopfend mitzulachen, gab es ernste Gesichter. Die Frau wurde zum Ufer gebracht und man zeigte ihr einen Leichnam – den von ihrem Ehemann.
Das hört sich sehr unterhaltsam an – das ist es aus. Interessanterweise hatte man in den Geschichten nur mit Ausländern zu tun. Aber insgesamt waren die Stories viel besser, als ich anfangs befürchtet hatte. Und als der andere 13er-Band aus den 1960er-Jahre, der bei Kiepenheuer erschienen war, vermuten ließ.
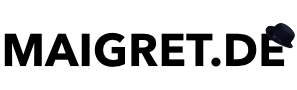

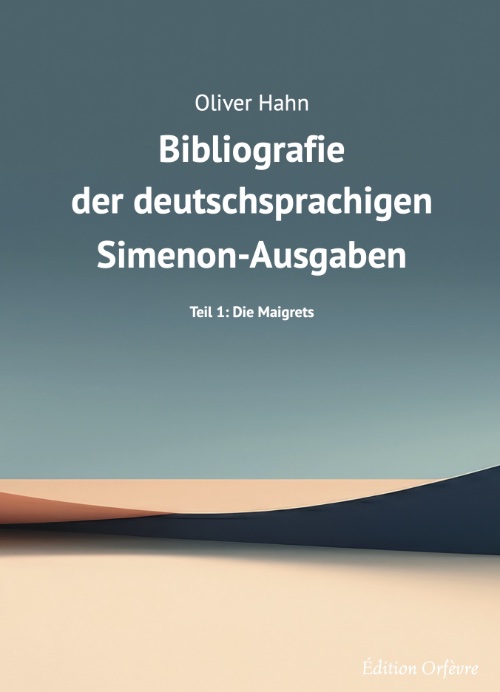 Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.
Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.